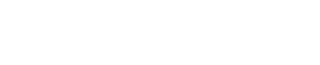So eine Welt ohne Ecken und Kanten
Kritik oder Konsum?
 Die
Konjunktur der Unschärfe in der Fotografie steht unter Verdacht.
Unlängst hat der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in ihr eine
gegenwartsbejahende "Ikonographie des guten Lebens" ausgemacht. Eine
Frau betrachtet unter einem Sonnenschirm am Meer ihre Kinder, ein
Wolkenkratzer schimmert im warmen Licht des Sonnenuntergangs und auf
einem Schreibtisch schwebt eine Lesebrille - quasi trunken von der
Lektüre - über dem Feuilleton. Sind diese Möst'schen Motive nun Chiffren
einer privilegierten Lebensform? Ästhetische Affirmationen an den
modernen Betrachter, der reizüberflutet die Beruhigung des Vagen und
Unverbindlichen sucht? Leicht konsumierbare Bilder, vielfach besetzt mit
Sehnsuchtssplittern gehobener Ansprüche? Ist der Fotograf Oliver Möst
also angekommen in der Leichtigkeit unscharf gezeichneter
Bedeutungswelten? Oder klingt etwa in der Unschärfe, die augenfällig als
das leitende ästhetische Prinzip seiner Arbeiten zu verstehen ist, eine
sinnliche Kritik an der visuellen Penetranz unserer Gegenwart an? Eine
Kritik gegen den Trend, alles zu zeigen. Alles sehen zu wollen oder
sehen zu müssen? Geht es meist um das Geheimnis hinter dem Sichtbaren?
Geht es um uns?
Die
Konjunktur der Unschärfe in der Fotografie steht unter Verdacht.
Unlängst hat der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in ihr eine
gegenwartsbejahende "Ikonographie des guten Lebens" ausgemacht. Eine
Frau betrachtet unter einem Sonnenschirm am Meer ihre Kinder, ein
Wolkenkratzer schimmert im warmen Licht des Sonnenuntergangs und auf
einem Schreibtisch schwebt eine Lesebrille - quasi trunken von der
Lektüre - über dem Feuilleton. Sind diese Möst'schen Motive nun Chiffren
einer privilegierten Lebensform? Ästhetische Affirmationen an den
modernen Betrachter, der reizüberflutet die Beruhigung des Vagen und
Unverbindlichen sucht? Leicht konsumierbare Bilder, vielfach besetzt mit
Sehnsuchtssplittern gehobener Ansprüche? Ist der Fotograf Oliver Möst
also angekommen in der Leichtigkeit unscharf gezeichneter
Bedeutungswelten? Oder klingt etwa in der Unschärfe, die augenfällig als
das leitende ästhetische Prinzip seiner Arbeiten zu verstehen ist, eine
sinnliche Kritik an der visuellen Penetranz unserer Gegenwart an? Eine
Kritik gegen den Trend, alles zu zeigen. Alles sehen zu wollen oder
sehen zu müssen? Geht es meist um das Geheimnis hinter dem Sichtbaren?
Geht es um uns?
Sehhilfen
 Oliver
Möst trägt eine Brille. Seine Sehschwäche: links 2,0 und rechts 6,0
Dioptrin. Fast 40 Millionen Menschen haben in Deutschland eine Brille
vor den Augen und setzen sich also, wenn auch nicht künstlerisch, so
doch gelegentlich mit dem Phänomen "Sehschwäche" auseinander. Ein guter
Grund, über das Sehen nachzudenken. Der Ausgang zur Betrachtung liegt
bei uns selbst. Was sehe ich? Was siehst du? Was sehen Sie? Bilder, die
scharf sind, haben die Unschärfe überwunden. Sie ignorieren die
Erfahrungen, die in der Unschärfe möglich sind. Wir wissen, was wir
sehen! Wenn es um die Bedeutung des Gesehenen geht, greifen wir auf
unser Wissen zurück. Ist das Bild gut oder schlecht, sagt es, bedeutet
es mir etwas - die Antwort liegt in der technischen und ästhetischen
Qualität des Bildes und in den Erfahrungen des Betrachters verborgen.
Und so geht das Bild eine Komplizenschaft mit unseren Sehgewohnheiten
ein. Dagegen wirkt Unschärfe irritierend auf den Betrachter. Sie
hinterfragt die Evidenz des Sehens: die Erkennbarkeit der Welt. Sie
kritisiert den visuellen Sinn, der oft allzu schnell erkennt, allzu
sicher einordnet und einsortiert. Unschärfe macht unsicher.
Oliver
Möst trägt eine Brille. Seine Sehschwäche: links 2,0 und rechts 6,0
Dioptrin. Fast 40 Millionen Menschen haben in Deutschland eine Brille
vor den Augen und setzen sich also, wenn auch nicht künstlerisch, so
doch gelegentlich mit dem Phänomen "Sehschwäche" auseinander. Ein guter
Grund, über das Sehen nachzudenken. Der Ausgang zur Betrachtung liegt
bei uns selbst. Was sehe ich? Was siehst du? Was sehen Sie? Bilder, die
scharf sind, haben die Unschärfe überwunden. Sie ignorieren die
Erfahrungen, die in der Unschärfe möglich sind. Wir wissen, was wir
sehen! Wenn es um die Bedeutung des Gesehenen geht, greifen wir auf
unser Wissen zurück. Ist das Bild gut oder schlecht, sagt es, bedeutet
es mir etwas - die Antwort liegt in der technischen und ästhetischen
Qualität des Bildes und in den Erfahrungen des Betrachters verborgen.
Und so geht das Bild eine Komplizenschaft mit unseren Sehgewohnheiten
ein. Dagegen wirkt Unschärfe irritierend auf den Betrachter. Sie
hinterfragt die Evidenz des Sehens: die Erkennbarkeit der Welt. Sie
kritisiert den visuellen Sinn, der oft allzu schnell erkennt, allzu
sicher einordnet und einsortiert. Unschärfe macht unsicher.
Sehen wir schlecht? Oder sehen wir anders?
Oliver Möst hat seine Brillenlinsen mit der Intention vor die Kamera montiert, um uns seine Sehschwäche zuzumuten. Jetzt haben wir seine Brille auf. Verschwommen, unscharf ist die Welt. Der Fisch im Museum schwimmt und das weiße Haus am Meer läuft auf dem Boden aus. Es entsteht eine Welt ohne Ecken und Kanten. Konturen, Identitäten, Personen lösen sich auf. Unschärfe-Techniken gelten als probate Mittel, innere Bilder, Traumsequenzen, Projektionen oder Rückblenden, Erinnerungen hervorzulocken. Unschärfe-Techniken führen uns aber auch den Wahrnehmungsprozess als solchen vor Augen. Sie verzögern ihn, sie öffnen ihn. Noch sucht der Blick Halt, doch schon beginnen die Farben und Schatten ihr Spiel. Die Bilder leben. Sie bewegen und verändern sich. Ist das unscharfe Bild nicht deshalb auch gerade das, was wir brauchen, fragt Ludwig Wittgenstein? Ein Versuch, das Leben mit anderen Augen sehen zu lernen? Auch wenn uns Oliver Möst eigentlich seine Brille aufsetzt, verlangen seine Bilder, sie abzunehmen. Nicht nur die Brille, die wir auf der Nase tragen, sondern auch die alte im Kopf.